Als an einem Samstagabend in Santiago de Chile die Gläser im Regal hin und her wandern, der Fernseher wackelt und dann auch noch das Haus beginnt zu schwanken, ist klar: ein Erdbeben! Das erste, das ich nicht verschlafe wie jenes in Wellington, das mit 4.2 auf der Richterskala durchaus bemerkenswert gewesen wäre. Aber ich habe eben einen festen Schlaf und dereinst muss wohl die Apokalypse ohne mich stattfinden…
Aber zurück zum Erdbeben. Während ich mich noch nicht entscheiden konnte, ob ich in Panik aus dem Haus stürzen oder mich mit stoischer Gelassenheit erst einmal im – nach wie vor rausgezeichnet funktionierenden – Internet über den Ernst der Lage informieren sollte, sprang mit einem Knall die Tür zum Wandschrank auf. Bücher, Haushaltsutensilien und der Schlafsack plumpsten auf den Boden. Nun wurde mir doch etwas mulmig, bis nach einer Minute der Spuk vorbei war. Auf der Straße blieb alles ruhig und getreu der Devise „do it as the locals do“ räumte ich den Wandschrank wieder ein und versuchte, meine flatternden Nerven wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Per WhatsApp wurde mir vom großen Chilenen freundlich beschieden, ich solle mich wieder beruhigen, es sei doch gar kein Erdbeben („Terremoto“) gewesen, sondern nur simple Erdstöße („Temblores“). Nun erschließt sich mir als Mitteleuropäerin diese Unterscheidung nicht, aber nun, wenn der wohlgemeinte Ratschlag lautet „ruhig bleiben und ein Glas Wein trinken“, halte ich mich natürlich daran. Allerdings steht seitdem eine gepackte Notfalltasche neben der Wohnungstür.
(Und es war doch ein Erdbeben! Mit 6.9 Magnitude vor der Küste Valparaísos ist das ein Erdbeben!)
Was es allerdings mit dem sehr beliebten Cocktail „Terremoto“ auf sich hat, werde ich noch genauer testen…



 Am Ende einer Reise steht immer ein Eindruck, ein Fazit des Landes. Um es vorweg zu nehmen: man kann sich sehr, sehr wohl fühlen bei den Kiwis. Und damit meine ich nicht den puscheligen kleinen Vogel, das Nationaltier Neuseelands. Die Einwohner nennen sich bekanntermaßen ebenfalls Kiwi und sind durchweg entspannte, aufgeschlossene und hilfsbereite Menschen. Wer sich selbst mit einem halbblinden, nachtaktiven und flugunfähigen Vogel identifiziert, hat ohnehin einen sehr sympathischen Sinn für Humor!
Am Ende einer Reise steht immer ein Eindruck, ein Fazit des Landes. Um es vorweg zu nehmen: man kann sich sehr, sehr wohl fühlen bei den Kiwis. Und damit meine ich nicht den puscheligen kleinen Vogel, das Nationaltier Neuseelands. Die Einwohner nennen sich bekanntermaßen ebenfalls Kiwi und sind durchweg entspannte, aufgeschlossene und hilfsbereite Menschen. Wer sich selbst mit einem halbblinden, nachtaktiven und flugunfähigen Vogel identifiziert, hat ohnehin einen sehr sympathischen Sinn für Humor! Indes, verbunden ist man via WiFi an fast jedem Ort der Insel, und insbesondere die beinahe überall gepflegte gute Sitte des kostenfreien WLAN in Bars, Cafés, Restaurants und Hotels macht es dem Reisenden sehr leicht, seine Planungen voranzutreiben. Die meisten Aktivitäten lassen sich online buchen, via Booking.com oder ähnliche Portale ist es überhaupt kein Problem, sich die nächste Übernachtung zu suchen. Staatliche wie private Einrichtungen haben meistens gut geführte Webseiten, deren Informationen leicht zugänglich sind. Besonders gut präsentieren sich natürlich die oben genannten Touranbieter für Vogelbeobachtungen. Der Kiwi 2.0 ist also lebendiger denn je. Übrigens hat Neuseeland nun auch eine Top Level-Domain namens
Indes, verbunden ist man via WiFi an fast jedem Ort der Insel, und insbesondere die beinahe überall gepflegte gute Sitte des kostenfreien WLAN in Bars, Cafés, Restaurants und Hotels macht es dem Reisenden sehr leicht, seine Planungen voranzutreiben. Die meisten Aktivitäten lassen sich online buchen, via Booking.com oder ähnliche Portale ist es überhaupt kein Problem, sich die nächste Übernachtung zu suchen. Staatliche wie private Einrichtungen haben meistens gut geführte Webseiten, deren Informationen leicht zugänglich sind. Besonders gut präsentieren sich natürlich die oben genannten Touranbieter für Vogelbeobachtungen. Der Kiwi 2.0 ist also lebendiger denn je. Übrigens hat Neuseeland nun auch eine Top Level-Domain namens 

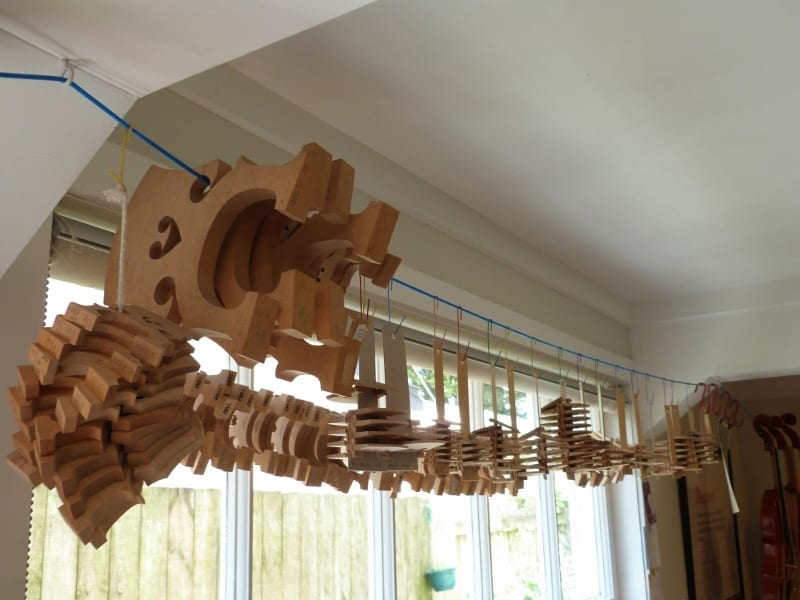


 Für den Nachmittag ist Regen angesagt, also ziehe ich den Fototermin lieber um einige Stunden vor. Mein Modell heute ist die „Ranui“, was auf Maori soviel wie „mitten am Tag“ heißt. Leider hat Richard dann keine Zeit. Als Anwalt für Marine- und Umweltrecht in eigener Kanzlei ist er gut beschäftigt, wenn er nicht gerade mit seiner „Mittagsfrau“ – der knapp 22 Meter langen
Für den Nachmittag ist Regen angesagt, also ziehe ich den Fototermin lieber um einige Stunden vor. Mein Modell heute ist die „Ranui“, was auf Maori soviel wie „mitten am Tag“ heißt. Leider hat Richard dann keine Zeit. Als Anwalt für Marine- und Umweltrecht in eigener Kanzlei ist er gut beschäftigt, wenn er nicht gerade mit seiner „Mittagsfrau“ – der knapp 22 Meter langen  1996 dann trat ihr heutiger Besitzer Richard auf den Plan. Der frühere Seemann, studierter Anwalt und aktiver Olympiateilnehmer, kaufte die Ranui und ließ sie zu einer Reise- und Charteryacht umbauen. „Ich wollte ein Boot, das sicher für meine junge Familie ist“, so Richard in einem
1996 dann trat ihr heutiger Besitzer Richard auf den Plan. Der frühere Seemann, studierter Anwalt und aktiver Olympiateilnehmer, kaufte die Ranui und ließ sie zu einer Reise- und Charteryacht umbauen. „Ich wollte ein Boot, das sicher für meine junge Familie ist“, so Richard in einem